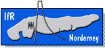Welchen Stellenwert haben Reha-Ziele in Forschung und Praxis?
Individuelle Zielvereinbarungen haben in der gesundheitspolitischen Diskussion seit ĂŒber 20 Jahren einen hohen Stellenwert. Dies gilt sowohl fĂŒr die Rehabilitation als auch die Akutversorgung (Stichwort âpartizipative Entscheidungsfindungâ). Auch die Diskussionen um eine stĂ€rkere Ergebnisorientierung in der Rehabilitation kann mit Reha-Zielen in Verbindung gebracht werden.
Im Rahmen der Rehabilitationsforschung sind inzwischen mehrere AnsĂ€tze zur Reha-Zielarbeit entwickelt und wissenschaftlich evaluiert worden, z.B. im gemeinsamen Förderschwerpunkt âChronische Krankheiten und Patientenorientierungâ des Bundesministeriums fĂŒr Bildung und Forschung (BMBF), der Deutschen Rentenversicherung Bund, der SpitzenverbĂ€nde der gesetzlichen Krankenkassen und des Verbandes der privaten Krankenversicherung e.V.. An dieser Stelle kann lediglich ein kurzer Ăberblick (s. Kasten 1.1) ĂŒber die ForschungsaktivitĂ€ten gegeben werden.
 Kasten 1.1: Publizierte Konzepte zur Reha-Zielarbeit aus dem deutschsprachigen Raum
|
Thema |
Projekt |
Inhalte |
Publikation |
|---|---|---|---|
|
Partizipative Zielvereinbarungen in EinzelgesprÀchen |
PARZIVAR |
Manual und Zielvereinbarungsformulare fĂŒr die Indikationen chronischer RĂŒckenschmerz, Herzinfarkt und Diabetes Mellitus |
Dibbelt et al., 2011 |
|
Partizipative Entscheidungsfindung zur StÀrkung der Patienten- und Mitarbeiterorientierung |
PEFiT |
Entwicklung und Evaluation eines Fortbildungsprogramms zur Partizipativen Entscheidungsfindung in der medizinischen Rehabilitation |
Körner, 2012 |
|
Rehabilitation mit hohem psycho-therapeutischem Anteil |
 |
KlÀrung des Therapieziels zu Beginn der Behandlung, indikationsspezifische Therapiezielkataloge |
Berking et al., 2003 |
|
Förderung von gesunder ErnÀhrung und Bewegung |
MoVo-Lisa |
Gruppenprogramm zur Lebensstil-integrierten sportlichen AktivitĂ€t, Transfer von neuen âgesĂŒnderenâ Verhaltensweisen in den Alltag |
Göhner & Fuchs, 2007 (s. auch Geidl et al., 2012) |
|
Nachhaltigkeit von Rehabilitationsergebnissen |
Neues Credo |
Zielsetzungen, die ĂŒber den Reha-Aufenthalt hinaus wirksam bleiben, Verbindung zur Nachsorge |
Deck et al., 2012 Â |
|
Zielarbeit in der medizinisch-beruflichen Orientierung |
ZaZo |
Gruppenintervention, Zielanalyse und Zieloperationalisierung in mehreren Stufen |
Hanna et al., 2010 |
FĂŒr den Bereich der medizinisch-beruflich orientierten Rehabilitation sei zudem auf das umfassende Arbeitsbuch âArbeits- und berufsbezogene Orientierung in der medizinischen Rehabilitationâ verwiesen, welches auch einige AnsĂ€tze zur partizipativen Entscheidungsfindung enthĂ€lt (Gerlich et al., 2012; Lukasczik et al., 2011).
Die derzeitige Umsetzungspraxis der Zielarbeit in der medizinischen Rehabilitation in Deutschland wird als defizitĂ€r beurteilt (Meyer et al., 2008; Schliehe, 2009). Auch sind wenige Studienergebnisse fĂŒr die Weiterentwicklung bestehender Konzepte verfĂŒgbar (Glattacker et al., 2013). Die Ăbersichtsarbeit von Buchholz und Kohlmann (2013) kommt zu dem Ergebnis, dass fĂŒr die Erfassung von Zielen im Bereich der medizinischen Rehabilitation nur wenige Erhebungsinstrumente zur VerfĂŒgung stehen, von denen sich bislang keines als Standard etabliert hat. Durch die hohe VariabilitĂ€t in der methodischen Vorgehensweise und Ergebnisdarstellung sei - so die Autoren - die studienĂŒbergreifende Vergleichbarkeit erheblich eingeschrĂ€nkt.
In der internationalen Literatur liegen Evaluationsergebnisse zur Reha-Zielarbeit bisher vor allem fĂŒr den Bereich der neurologischen Rehabilitation vor (u.a. Rosewilliam et al., 2011). Es ist jedoch zu bedenken, dass die langfristig auf Teilhabe und SekundĂ€rprĂ€vention ausgerichtete Behandlung bei anderen chronischen Krankheiten hier oftmals nicht unter dem Schlagwort âRehabilitationâ gefĂŒhrt wird. Im deutschen Sozialversicherungssystem findet sie dagegen als âmedizinische Rehabilitationâ sowohl in ambulanten als auch im stationĂ€ren Sektor statt.
FrĂŒhere systematische Reviews zu Zielvereinbarungen haben gezeigt, dass die unmittelbare Performanz von Patienten das Aufgaben-Pensum und die AdhĂ€renz in Bezug auf Behandlungsregimes durch Goal Setting verbessert werden konnten, nicht jedoch distale Outcomes der Rehabilitation (Levack et al., 2006). Die Ergebnisse wurden von Rosewilliam et al. (2011) und Sugavanam et al. (2013) reproduziert.
Ein aktualisiertes Cochrane-Review von Levack et al.: "Goal setting and strategies to enhance goal pursuit for adults with acquired disability participating in rehabilitationâ kommt nach dem Einschluss von 39 Studien zu dem Schluss, dass es eine schwache Evidenz geringer QualitĂ€t dafĂŒr gibt, dass Zielvereinbarungen (Goal Setting) bei erworbenen Behinderungen einige Outcomes verbessern können. Dabei scheinen positive Effekte auf psychosoziale Reha-Ergebnisse (gesundheitsbezogene LebensqualitĂ€t, emotionaler Status und Selbstwirksamkeit) eher gesichert als solche auf physische Ergebnisse. Diese Effekte sind jedoch aufgrund der Studienlage als sehr unsicher zu betrachten (Levack et al., 2015).Â